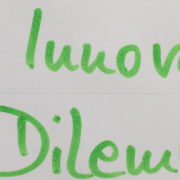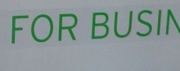Bibliotheken verfügen vielfach über ungenutzte Schätze, können sie aber nicht ihren Kunden verfügbar machen, da sie nicht über die notwendigen Kapazitäten oder auch nicht über die Kenntnisse verfügen. Die Crowd – die Öffentlichkeit – verfügt dagegen vielfach genau über dieses Wissen. Crowdsourcing ist somit eine Möglichkeit, die kundenorientierten Services auszuweiten bzw. zu optimieren.
Gebert definiert Crowdsourcing wie folgt: „Ein heterogener, nicht-definierter Personenkreis arbeitet im globalen Raum zusammen an einem gemeinsamen Ziel.“ Über Crowdsourcing können z.B. Aufgaben, die eine Einrichtung alleine nicht bewältigen kann, an Externe ausgelagert werden. Neu ist das Phänomen des Crowdsourcings jedoch nicht. Schon in der Vor-Internet-Zeit haben viele Beispiele von Crowdsourcing-ähnlichen Arbeitsgemeinschaften existiert. Das sicher bekannteste Beispiel eines frühen Crowdsourcings ist das Oxford English Dictionary: ihre Begründer hatten Mitte des 19. Jahrhunderts das ehrgeizige Ziel, ein Inventar der gesamten englischen Sprache zum damaligen Zeitpunkt, das zudem die historische Entwicklung einzelner Wörter abbilden sollte, zu schaffen. 1879 erfolgte der Aufruf an die englische Bevölkerung mit der Bitte, Belegstellen für alltägliche und ungewöhnliche Wörter zuzusenden. Und dem Prinzip ist das Oxford English Dictionary bis heute treu geblieben, wobei es vor allem die Suche nach Erstbelegen – also den ersten schriftlich dokumentierten Verwendungen von Wörtern – geht. Diese werden häufig von Laien an die Redaktion geschickt, wo sie dann sorgfältig geprüft werden, bevor sie aufgenommen werden.
Allerdings haben besonders die Web 2.0-Mechanismen und -Möglichkeiten den Einsatz der Masse stark vereinfacht. Modernes Crowdsourcing wird als eine Online-Aktivität verstanden, wobei das Internet als Bedingung vorausgesetzt wird. Non-Profit-Organisationen fungieren ebenso wie Unternehmen und Institutionen als Auftraggeber – als Crowdsourcer. Auf der anderen Seite stehen die Auftrags- bzw. Aufgabenempfänger – die Crowd, die gemeinsam an Lösungen einer konkreten Aufgabenstellung arbeitet. Die Crowdworker, die Mitglieder der Crowd, sind somit eine heterogene Gruppe von Individuen mit unterschiedlichen Kenntnissen, die über einen (offenen) Aufruf zur freiwilligen Mitarbeit an der Lösung von konkret gestellten Aufgaben motiviert und aktiviert werden.
Immerhin geht man davon aus, dass rund 10-40% aller Kunden bereit sind, sich an Crowdsourcing oder Open Innovation zu beteiligen. Und selbst wenn es nur ein Prozent ist, dann bekommt jede Bibliothek einen zusätzlichen Input zu Projekten, die sie möglicherweise alleine gar nicht alleine hätte stemmen können. Allerdings gilt auch im Crowdsourcing-Prozess die typische 90-9-1-Regel, die besagt, dass nur ein Prozent der Teilnehmer die realisierbaren Inhalte erstellen, neun Prozent sich an der Modifizierung der Inhalte beteiligen, während 90 Prozent der Teilnehmer die Inhalte lediglich konsumieren.
Und wo können Bibliotheken Crowdsourcing z.B. einsetzen?
– bei der Content-Erstellung: Archiverstellung, Erhalten von Kulturgut, Transkription etc.
– bei Innovationsprojekten: Entwicklung neuer Produkte / Dienstleistungen
– im Marketing: Content-Marketing
– bei der Trendermittlung: Bestandsermittlung etc.
Der Fantasie sind letztendlich aber keine Grenzen gesetzt. Die meisten bibliothekarischen Crowdsourcing-Projekte sind jedoch dem Feld der Content-Erschließung zuzuordnen, wobei ein Schwerpunkt auf dem Erhalt von Kulturgut liegt. Die Verwendung von Crowdsourcing in Institutionen, die sich mit Kulturgut beschäftigen (Bibliotheken, Museen und Archive) bringt mehrere Vorteile mit sich. Viele der Projekte ließen sich ohne Crowd personell nicht bewältigen. Zudem werden Personen angesprochen bzw. fühlen sich angesprochen, die sich in dem Bereich sehr gut auskennen oder sich dafür begeistern. Gleichzeitig wirkt das Crowdsourcing als Marketinginstrument, denn es werden möglicherweise Zielgruppen erreicht, die bisher noch nicht im Fokus der Bibliothek standen oder die Bibliothek bisher unzureichend erschlossen hat. Zudem erlaubt diese Form des Crowdsourcings den Bürgern, ihre Interessen zu wahren. Simone Waidmann schreibt dazu: „Dies stärkt das Gefühl für Kulturgut als Gemeineigentum und die gemeinsame Verantwortung für dessen Bewahrung. Die Nutzer erhalten die Gelegenheit, sich sozial zu engagieren, ihre Zeit und Expertise zum Wohl der Gesellschaft einzubringen […]“.
Verbunden mit Crowdsourcing sind natürlich auch Risiken. So könnten bei Transkriptionsprojekten Texte manipuliert werden, oder die Bibliotheken könnten mit Spams überflutet werden, Gehört hat man davon bisher aber nichts. Und wahrscheinlich sind diese Aufgaben auch zu herausfordernd. Wer sich mit diesen Themen befasst, ist gewillt, einen ernsthaften Input mit Wert zu generieren. Crowdsourcing wird vielfach auch als digitale Jobvernichtung bezeichnet, da befürchtet wird, dass digitale Arbeitsnomaden und Selbständiger, die projektbasierte Jobs annehmen und keinerlei soziale Absicherung genießen – zum Normalfall werden könnten. Für Bibliotheken gilt diese Befürchtung sicher nicht. Die Projekte, die sich in Bibliotheken für Crowdsourcing eignen, würden ohne eine Crowd vielfach gar nicht bewältigt werden. So ist das Crowdsourcing auf jeden Fall ein Gewinn für die Kunden und in vielen Fällen auch für die Gesellschaft. Daher sollten Bibliotheken mehr Mut aufbringen, Externe – Kunden und Nicht-Kunden – stärker in ihre (Innovations-)projekte mit einzubinden.
Weitere Details und Beispiele finden sich u.a. bei:
Georgy, Ursula (2015). Crowdsourcing – Ein Leitfaden für Bibliotheken. B.I.T.online – Innovativ, Band 52. Wiesbaden: Dinges & Frick.
Waidmann, Simone (2014). Erschließung historischer Bestände mittels Crowdsourcing: eine Analyse ausgewählter aktueller Projekte. In: Perspektive Bibliothek, Bd. 3, Nr. 1, 2014, S. 33-58.
URL: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bibliothek/article/download/14020/7903
Quellen
1 Gebert, Michael, zit. nach Unterberg, Bastian (2010): Crowdsourcing (Jeff Howe). In: Michelis, Daniel.; Schildhauer, Thomas (Hrsg.). Social Media Handbuch: Theorien, Methoden, Modelle. Baden-Baden: Nomos, S. 134-148.
2 Vgl. Nielsen, Jakob (2006): The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities. NN/g Nielsen Norman Group, 09.10.2016. URL: https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/
3 Waidmann, Simone (2014). Erschließung historischer Bestände mittels Crowdsourcing: eine Analyse ausgewählter aktueller Projekte. In: Perspektive Bibliothek, Bd. 3, Nr. 1, 2014, S. 33-58.