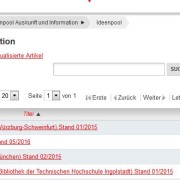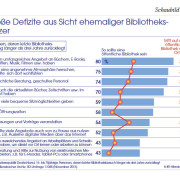Was hat Job-Shadowing mit kundenorientierten Services zu tun? Eine Menge, denn es ist eine hervorragende Möglichkeit, die Arbeit von Bibliotheken näher kennen zu lernen und damit auch die Arbeitsweise, die angebotenen Dienstleistungen etc.
Das ursprünglich aus den USA stammende Job Shadowing soll High-School-Schülern einen ersten Eindruck von ihrem möglichen künftigen Beruf vermitteln. Inzwischen hat sich das Konzept auch in Deutschland etabliert. Im Gegensatz zu einem Praktikum dauert das Job Shadowing jedoch nur einen Tag. Dabei begleitet der Shadower eine Person in einem Unternehmen oder einer Einrichtung während ihres normalen Berufsalltags und lernt deren Tätigkeiten und die damit verbundene Arbeitswelt real kennen. Wie die Bezeichnung es schon ausdrückt, beschränkt sich die Rolle des Shadowers auf die reine Beobachtung, d.h. der Beobachtende arbeitet selbst nicht mit.
So ein Job Shadowing-Tag hat im Allgemeinen folgenden Ablauf: Begrüßung, Kennenlernen und Informationsphase, kurze Abteilungs-/ Unternehmensführung, Teilnahme am „normalen“ Arbeitstag mit Meetings, internen und / oder externen Kundenkontakten und -terminen, Einblick in aktuelle Arbeitsaufgaben und Problemstellungen, Abschlussgespräch und Feedback.
Bisher bieten nur wenige Bibliotheken in Deutschland Job Shadowing an, obwohl sich dieses Instrument gut dafür eignet, die öffentliche Wahrnehmung von Bibliotheken zu verbessern und ein realistisches Bild des Berufs Bibliothekar zu vermitteln. Die Methode ist an amerikanischen Bibliotheken fest etabliert: dort werden Schüler im Alter von 12-18 Jahren angesprochen, so dass sie sich schon frühzeitig Gedanken zu ihrer Berufswahl machen können. Aber auch während eines Studiums bietet sich ein solches Job Shadowing an, um die verschiedenen Berufsperspektiven kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, mit Menschen über deren Tätigkeiten und Karrierewege zu sprechen und last but not least, ein realistisches Bild für die eigene Zukunft zu entwickeln.
Die ALA hat für Öffentliche Bibliotheken einen Leitfaden erstellt, wie ein solches Job Shadowing zu organisieren ist und wie es ablaufen sollte / könnte. Die ALA empfiehlt für Schüler, die keine Möglichkeit haben, an einem „realen“ Job Shadowing teilzunehmen, ein „virtuelles“ Job Shadowing; auch dieses ist beschrieben. Und ein solches Job Shadowing ist ebenfalls in den USA ebenfalls u.a. in Schulbibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken systematisch etabliert.
Die ALA und damit auch die Bibliotheken verstehen die Methode als Job-Recruiting und Personalmarketing. In Zeiten des Fachkräftemangels, begrenzten Gehältern und Aufstiegschancen im öffentlichen Dienst könnte Job Shadowing in Deutschland ebenfalls eine geeignete Maßnahme sein, auch künftig für die Absolventen der bibliothekarischen und informationswissenschaftlichen Studiengänge attraktiv zu sein.
Weitere Informationen finden sich u.a. unter:
YALSA – Young Adult Library Services Association: YALSA´s Professional Tools – Job Shadowing Toolkit:
http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/final job shadowing toolkit public librarian.doc