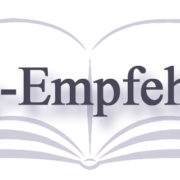Kundenbefragungen sind ein gutes Arbeitsinstrument, um die Zufriedenheit und Wünsche der Kunden besser kennenzulernen. Anschließend kann man Angebote und Services ziel(gruppen)genauer ausrichten, die Effizienz und Effektivität des bibliothekarischen Handelns steigern und auf beiden Seiten für mehr Zufriedenheit sorgen.
Natürlich kann dieses Instrument auch für einzelne Teilgruppen der Kunden angewandt werden, wie das folgende Beispiel aus Biberach an der Riß zeigt.
Im „Netzwerk Lesen“ des Medien- und Informationszentrums Stadtbücherei Biberach (MIZ) haben sich 55 Bildungspartner mit dem Ziel der gemeinschaftlichen Leseförderung zusammengeschlossen. Darunter sind mehr als 30 Kinderkrippen und Kindergärten, die von der Stadtbücherei mit Medien, Beratung und bibliothekspädagogischen Angeboten unterstützt werden. Der Freundeskreis der Stadtbücherei „Lust auf Lesen e.V.“ unterstützt zudem mit Buchgeschenken und der Vermittlung von Vorlesepaten. Die Kindertagesstätten bieten ihren Kindern gemütliche Leseecken und Lesenester, drei sogar eigene Büchereien an.
Nachdem das „Netzwerk Lesen“ auf lokaler Ebene seit Herbst 2017 vollständig ist, wollte die Stadtbücherei durch eine erneute Befragung der Zielgruppe erfahren, wie in den Kindertagesstätten die derzeitige Ausstattung mit Medien ist, wie diese zur Lesefrühförderung eingesetzt werden und welche Wünsche die Kitas zur weiteren Verbesserung der Sprach- und Leseförderung haben.
Nach telefonischer Terminabsprache hat dazu Bibliothekarin Klara Armstrong im Frühsommer 2018 insgesamt 24 Kindertagesstätten in Biberach und seinen Teilorten (33.000 Einwohner) persönlich besucht. Dabei hat sie den Erzieherinnen Fragen zum Thema Lesefrühforderung gestellt. Die einstündigen ausführlichen Interviews haben geholfen, die Einstellungen der Kindetagesstätten zur Sprach- und Lesefrühforderung besser zu verstehen und haben die Basis für ein Handlungskonzept der Stadtbücherei für die nächsten Jahre geschaffen. Die Fragen betrafen den Bestand der Kindergartenbüchereien, deren aktuelle Verwendung sowie die Vorstellungen zum zukünftigen Einsatz insbesondere von digitalen Medien zur Sprach- und Leseförderung.
In Biberach sind die meisten Kindertagesstätten in städtischer oder konfessioneller Trägerschaft. Sie haben meist zwischen 51 – 60 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren. Alle richten sich inhaltlich nach dem baden-württembergischen Orientierungsplan, der fünf verschiedene Schwerpunkte ermöglicht. Ein Viertel der befragten 24 Kitas haben die Sprachförderung zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Die Hälfte davon hat dies in einem schriftlichen Konzept hinterlegt, in dem auch die Stadtbücherei explizit als Bildungspartner genannt wird. Fast alle KiTas, die mehr als 20 % Kinder mit geringen Deutschkenntnissen haben, bieten für diese Kinder eine spezielle zusätzliche Förderung.
Im Durchschnitt hat jede KiTa in Biberach rund 520 Bücher im Bestand, davon 413 Kinderbücher. Damit hat sich die Medienausstattung seit der ersten Erhebung 2010 um 17 % verbessert. Der Anteil der Kinderbücher ist überproportional um 32 % gestiegen. Leider kann sich nur ein Viertel der Kinder in den befragten Kitas jederzeit selbstständig mit Büchern beschäftigen und nur in 58 % der Kitas können die Kinder Bücher nach Hause ausleihen. Hier sieht das MIZ zukünftig weiteren Informationsbedarf, um die haptische Erfahrung der Kinder mit Büchern und das Vorlesen in buchfernen Haushalten zu fördern.
In den Kindertagesstätten wird meist täglich durch die Erzieherinnen vorgelesen, mehr als die Hälfte der befragten Kitas greift zusätzlich auf das Angebot der Vorlesepaten und auf Eltern und ältere Schüler zurück. Die Vorlesezeiten sind dadurch im Vergleich zu 2010 um 15 % auf 62 Minuten täglich gestiegen! Zur Sprach- und Lesefrühförderung werden überwiegend gedruckte Bücher eingesetzt. Mehr als die Hälfte der befragten Kitas möchte derzeit keine digitalen Medien dazu einzusetzen.
Die Stadtbücherei bietet ein breites Spektrum von Services für ihre Partner: Montessori-Materialien, Medienboxen, Leselotten, Erlebnisführungen für Kinder und Eltern, bibliothekspädagogische Angebote sowie kostenlose Institutionsausweise für die ErzieherInnen. Alle befragten Kindertagesstätten sind mit dem Angebot der Stadtbücherei sehr zufrieden. Individuelle Wünsche wie z.B. mehr Kamishibais wurden aufgenommen und zeitnah umgesetzt. Um den Kontakt zum Buch noch früher zu ermöglichen, sollen zukünftig die Angebote für die „Windelflitzer“ weiter ausgebaut werden.
Klara Armstrong, Frank Raumel 10/2018